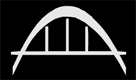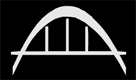Sigarews Name und sein Theaterstück
“Plastilin” riss die Theaterwelt vor wenigen Jahren durch seine lebensnahen
Inhalte beinahe auseinander. Ein Jugendlicher, der in einer apokalyptischen
Welt untergeht und sie letztendlich verdammt, schockiert den Betrachter.
Deutsche Zuschauer konnten die Verfilmung dieses Werks in der Inszenierung
vom Moskauer Regisseur Kirill Serebrennikow bereits 2002 sehen.
Mit dem Theaterstück “Schwarze Milch” setzt
Sigarew das Thema der “Unreinheit”, sowohl der innerlichen als auch der
äußerlichen, fort. Bereits in den ersten Zeilen seines Stücks sagt der
Autor: ”Du Dreckige Grenzenlose Heimat Mein!”
Welcher Russe kennt nicht
heruntergekommene, scheußlich riechende Bahnhofshallen mit vollgespuckten
Sitzen und schäbigen Wänden, Dreck ohne nur irgendwelche
Zivilisationsspuren, russisches Volk in abgeschabten gesteppten
Bauernjacken und im Alkoholdunst?
An so einer kleinen Bahnstation mitten im
Nirgendwo landet ein junges Paar. Raffiniert drehen die beiden zynischen
Moskauer Händler bettelarmen einfältigen Hinterwäldlern ganz gewöhnliche
Toaster aus Kunststoff an. Diese Narren schmeißen ihren halben Monatslohn
dafür weg. Der Wucher fliegt auf. Die Dorfbewohner kommen mit den Toastern
zurück und wollen ihr Geld wieder haben. Lewtschik und Kleine (so nennen
sich die jungen Leute) fertigen das Volk obszön ab. Diese ziehen weg “...
mit hoffnungslos ausgebreiteten Armen”, um mit Gedichtzeilen Nekrasows zu
sprechen. Die jungen Leute sind zufrieden - haben eben viel Kohle abgezockt.
Wenn nur nicht ein “Aber” dazwischen käme. Die junge Frau ist im achten
Monat schwanger. Anstatt in einer Moskauer Privatklinik muß sie jetzt in
diesem “vom Gott verlassenen” Drecksloch ihr Kind zur Welt bringen.
Der zweite Akt versetzt uns an die gleiche
Stelle, nur 10 Tage nach der Geburt des Babys. Lewtschik will mit seiner
Frau endlich die Rückreise in die Zivilisation, nach Moskau, antreten.
Plötzlich beschließt die junge Frau, auf dem Land mit den einfachen
russischen Menschen zu leben. Warum sind ihr diese Bauerntölpel plötzlich so
herzensnah und seelenverwandt geworden? Darüber erfahren Sie in der
Aufführung der Theatergruppe “Brücken”, inszeniert von Elena Forr.
Das Stück impliziert viele Aspekte - es
gibt Raum für Paradoxie, Lachen und Tränen. Ein russischer Zuschauer wird
möglicherweise einen Hauch von Nostalgie verspüren nach den Menschen, mit
denen er seine Kindheits- und Jugendjahre verbracht hat. Einem deutschen
Zuschauer könnte ein tieferer Sinn des Begriffs “russische Seele” offenbart
werden.